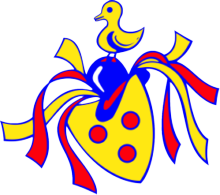historisches
über uns > Chronik
Name und Archäologie
D er Name des Ortes "Essingen" wird, wenn auch in etwas abgewandelter Form, bereits im ausgehenden 11. Jahrhundert urkundlich genannt. Die Frage nach der Ableitung des Ortsnamens ist bisher noch nicht eindeutig geklärt worden. Zum einen besteht eine mögliche Beziehung zu der im Gemeindewappen geführten Esse, zum anderen ist es jedoch wahrscheinlich, dass der Ortsname mit dem Namen eines früheren Stammeshäuptling zusammenhängt, der Ezzillo, Esso oder ähnlich hiess. Ein Bestehen der Siedlung zu früherer Zeit konnte bei Renovierungsarbeiten bei der evangelischen Kirche nachgewiesen werden. Bei Ausschachtungsarbeiten der evangelischen Quirinuskirche stiess man auf Grundmauern vorhergehender Bauwerke, die sicher dem gleichen Zweck gedient haben dürften. Es fanden sich auch schön behauene Steinquader, von denen vermutet wird, dass sie Teile eines heidnischen Heiligtums gewesen sein könnten, die dann bei nachfolgenden Sakralbauten wieder verwendet wurden. Die archäologischen Zeugnisse, die in und um Essingen gefunden wurden, sprechen dafür, dass die Siedlung wesentlich älter ist. Im Wald Wehrenfeld zwischen Essingen und Bartholomä wurden keltische Grabhügel gefunden. Dies lässt den Schluss zu, dass die Markung bereits in vorchristlicher Zeit besiedelt war.In römischer Zeit lag Essingen in der "besetzten" Zone, hinter dem Limes (Weltkulturerbe), der durch die nördliche Gemarkung in der Nähe des Sixenhofes verlief.Die Spuren von Siedlungen aus jenen Jahren sind meist durch die Wirren der Völkerwanderung verwischt oder gelöscht worden. Wie schon erwähnt, reicht das erste Zeugnis von der Existenz Essingens ins 11. Jahrhundert zurück. Damals gehörten das Land wie auch die Bauern den Adeligen.
er Name des Ortes "Essingen" wird, wenn auch in etwas abgewandelter Form, bereits im ausgehenden 11. Jahrhundert urkundlich genannt. Die Frage nach der Ableitung des Ortsnamens ist bisher noch nicht eindeutig geklärt worden. Zum einen besteht eine mögliche Beziehung zu der im Gemeindewappen geführten Esse, zum anderen ist es jedoch wahrscheinlich, dass der Ortsname mit dem Namen eines früheren Stammeshäuptling zusammenhängt, der Ezzillo, Esso oder ähnlich hiess. Ein Bestehen der Siedlung zu früherer Zeit konnte bei Renovierungsarbeiten bei der evangelischen Kirche nachgewiesen werden. Bei Ausschachtungsarbeiten der evangelischen Quirinuskirche stiess man auf Grundmauern vorhergehender Bauwerke, die sicher dem gleichen Zweck gedient haben dürften. Es fanden sich auch schön behauene Steinquader, von denen vermutet wird, dass sie Teile eines heidnischen Heiligtums gewesen sein könnten, die dann bei nachfolgenden Sakralbauten wieder verwendet wurden. Die archäologischen Zeugnisse, die in und um Essingen gefunden wurden, sprechen dafür, dass die Siedlung wesentlich älter ist. Im Wald Wehrenfeld zwischen Essingen und Bartholomä wurden keltische Grabhügel gefunden. Dies lässt den Schluss zu, dass die Markung bereits in vorchristlicher Zeit besiedelt war.In römischer Zeit lag Essingen in der "besetzten" Zone, hinter dem Limes (Weltkulturerbe), der durch die nördliche Gemarkung in der Nähe des Sixenhofes verlief.Die Spuren von Siedlungen aus jenen Jahren sind meist durch die Wirren der Völkerwanderung verwischt oder gelöscht worden. Wie schon erwähnt, reicht das erste Zeugnis von der Existenz Essingens ins 11. Jahrhundert zurück. Damals gehörten das Land wie auch die Bauern den Adeligen.
 er Name des Ortes "Essingen" wird, wenn auch in etwas abgewandelter Form, bereits im ausgehenden 11. Jahrhundert urkundlich genannt. Die Frage nach der Ableitung des Ortsnamens ist bisher noch nicht eindeutig geklärt worden. Zum einen besteht eine mögliche Beziehung zu der im Gemeindewappen geführten Esse, zum anderen ist es jedoch wahrscheinlich, dass der Ortsname mit dem Namen eines früheren Stammeshäuptling zusammenhängt, der Ezzillo, Esso oder ähnlich hiess. Ein Bestehen der Siedlung zu früherer Zeit konnte bei Renovierungsarbeiten bei der evangelischen Kirche nachgewiesen werden. Bei Ausschachtungsarbeiten der evangelischen Quirinuskirche stiess man auf Grundmauern vorhergehender Bauwerke, die sicher dem gleichen Zweck gedient haben dürften. Es fanden sich auch schön behauene Steinquader, von denen vermutet wird, dass sie Teile eines heidnischen Heiligtums gewesen sein könnten, die dann bei nachfolgenden Sakralbauten wieder verwendet wurden. Die archäologischen Zeugnisse, die in und um Essingen gefunden wurden, sprechen dafür, dass die Siedlung wesentlich älter ist. Im Wald Wehrenfeld zwischen Essingen und Bartholomä wurden keltische Grabhügel gefunden. Dies lässt den Schluss zu, dass die Markung bereits in vorchristlicher Zeit besiedelt war.In römischer Zeit lag Essingen in der "besetzten" Zone, hinter dem Limes (Weltkulturerbe), der durch die nördliche Gemarkung in der Nähe des Sixenhofes verlief.Die Spuren von Siedlungen aus jenen Jahren sind meist durch die Wirren der Völkerwanderung verwischt oder gelöscht worden. Wie schon erwähnt, reicht das erste Zeugnis von der Existenz Essingens ins 11. Jahrhundert zurück. Damals gehörten das Land wie auch die Bauern den Adeligen.
er Name des Ortes "Essingen" wird, wenn auch in etwas abgewandelter Form, bereits im ausgehenden 11. Jahrhundert urkundlich genannt. Die Frage nach der Ableitung des Ortsnamens ist bisher noch nicht eindeutig geklärt worden. Zum einen besteht eine mögliche Beziehung zu der im Gemeindewappen geführten Esse, zum anderen ist es jedoch wahrscheinlich, dass der Ortsname mit dem Namen eines früheren Stammeshäuptling zusammenhängt, der Ezzillo, Esso oder ähnlich hiess. Ein Bestehen der Siedlung zu früherer Zeit konnte bei Renovierungsarbeiten bei der evangelischen Kirche nachgewiesen werden. Bei Ausschachtungsarbeiten der evangelischen Quirinuskirche stiess man auf Grundmauern vorhergehender Bauwerke, die sicher dem gleichen Zweck gedient haben dürften. Es fanden sich auch schön behauene Steinquader, von denen vermutet wird, dass sie Teile eines heidnischen Heiligtums gewesen sein könnten, die dann bei nachfolgenden Sakralbauten wieder verwendet wurden. Die archäologischen Zeugnisse, die in und um Essingen gefunden wurden, sprechen dafür, dass die Siedlung wesentlich älter ist. Im Wald Wehrenfeld zwischen Essingen und Bartholomä wurden keltische Grabhügel gefunden. Dies lässt den Schluss zu, dass die Markung bereits in vorchristlicher Zeit besiedelt war.In römischer Zeit lag Essingen in der "besetzten" Zone, hinter dem Limes (Weltkulturerbe), der durch die nördliche Gemarkung in der Nähe des Sixenhofes verlief.Die Spuren von Siedlungen aus jenen Jahren sind meist durch die Wirren der Völkerwanderung verwischt oder gelöscht worden. Wie schon erwähnt, reicht das erste Zeugnis von der Existenz Essingens ins 11. Jahrhundert zurück. Damals gehörten das Land wie auch die Bauern den Adeligen.Essingen und die Adeligen

Aus der amtlichen Beschreibung der Landesarchivdirektion Baden-Württemberg (Das Land Baden-Württemberg,
Bd. IV) entnehmen wir folgendes: Um 1090 schenkte Graf Werner von
Grüningen dem Kloster Hirsau eine "curtis" mit anhängigen "mansen".
1241
muss wenigstens ein Teil von Essingen in Reichsbesitz gewesen sein,
wird doch Essingen mit einem Betrag von 5 Mark Silber im
Reichssteuerverzeichnis aufgeführt. Möglicherweise ist das der Hirsauer
Besitz, der als Kirchenlehn an die Staufer gekommen sein könnte.

Um
1345, vielleicht aber schon seit spätstaufischer Zeit, war der Ort mit
der Herrschaft Lauterburg im Besitz der Gräfin von Öttingen, dann
Pfandbesitz Graf Eberhards des Greiners von Württemberg. Dieser musste
den Besitz 1360 an Karl IV. herausgeben, erhielt ihn jedoch 1361 wieder
zurück.
Von
Württemberg kam Essingen 1410 zunächst als Pfand und 1479 als Lehen an
die Woellwarth, die im 16. Jahrhundert die Güter anderer Grundbesitzer
(Spital Gmünd, das Kloster Gotteszell und Kirchheim am Ries sowie von
Horkheim auf Schnaitberg) aufkauften und 1542 den Blutbann sowie 1548
die Zollhoheit erhielten.
Ein
erstes Privileg von 1480 für den "Markt" Essingen wurde 1685 erneuert.
Ein Drittel des Dorfes mit der Oberburg und Anteilen an den
Hoheitsrechten verkauften die Woellwarths 1696/97 an die Herren von
Degenfeld. 1806 fiel der beim Ritterkanton Kocher immatrikulierte Ort an
Württemberg.Essingen hatte in ältester Zeit zwei Pfarrkirchen, von
denen eine im 12. Jahrhundert zum Kloster Hirsau gehörte. Auf seine
Rechte an beiden Kirchensätzen verzichtete 1313 das Kloster Neresheim
gegenüber dem Kloster Ellwangen.
Kaiser
Karl IV. schenkte 1361 die Pfarrkirche mit der Tochterkirche dem
Kloster Neresheim, das sie 1538 beide an die Ortsherrenschaft verkaufte.
Die Kaplaneipfründe am Liebfrauenaltar kam 1479 von den von Schnaitberg
an die Woellwarth; sie scheint mit der zweiten Pfarrei infolge der von
den Woellwarth durchgeführten Reformation eingegangen zu sein.
 Seit
1696 hatten auch die Herren von Degenfeld Anteil am Patronat.Die evang.
Pfarrkirche "St. Quirinus" stammt so etwa um 1521, spätgotisch, wurde
mehrmals, umgebaut. 2004 wurde die Dachkonstruktion des Turms
grundlegend Saniert und 2005 das Dach des Kirchenschiffs komplett
erneuert. Eine umfassende Innenrenovierung konnte 2010 abgeschlossen
werden.
Seit
1696 hatten auch die Herren von Degenfeld Anteil am Patronat.Die evang.
Pfarrkirche "St. Quirinus" stammt so etwa um 1521, spätgotisch, wurde
mehrmals, umgebaut. 2004 wurde die Dachkonstruktion des Turms
grundlegend Saniert und 2005 das Dach des Kirchenschiffs komplett
erneuert. Eine umfassende Innenrenovierung konnte 2010 abgeschlossen
werden.Von
der zweiten Pfarrkirche auf dem Friedhof, um 1400 erbaut, steht nur
noch der kreuzgewölbte, platt geschlossene Chor. Die katholische
Pfarrkirche "Herz Jesu" wurde im Jahr 1947 erbaut; die kath. Pfarrei
besteht seit 1972.
Grundsätzliches und Namensgebung der Haugga-Narra
"Die edle Familie der Hacken" - unsere Namensgeber
In
einer Urkunde von 1128 wird ein Adalbert "palantinis de Luterburch"
(Pfalzgraf von Lauterburg) aufgeführt. Dieser starb erbenlos, auch waren
aus der Dillinger Linie keine Nachfolger  vorhanden, so dass der Besitz
von den Herzögen von
Hohenstaufen an sich gezogen wurde. Die Verwaltung übernahm in der
Folgezeit "die edle Familie der Hacken" (Haggen). Im Jahre 1257 wird ein
Walterus Haggo nobilis de Luterburch (Edler von Lauterburg) urkundlich
erwähnt. 1269 nennt er sich Waltherus Haggo de Welrstein, sein Siegel
führt aber die Umschrift etc. de Lutterburg. Hierbei handelt es sich um
das bereits ausgestorbene Geschlecht der Hack von Hoheneck. Nach dem
O.A. Ludwigsburg zufolge handelt es sich hierbei um Edelherren vom
Stamme der Heinrith, Geschlechtsgenossen der Hummel v. Lichtenberg. Nach
Mitte des 13. Jahrhunderts nennen sich auch von Lauterburg und
Wellstein (O.A. Aalen) und von Rosenstein (O.A. Gmünd). Das Wappen der
Familie Hacken von Hoheneck bzw. Hacken auf Lauterburg ist wie folgt
beschrieben: In Silber (weiß) drei rote Kugeln (2:1). Die Helmdecke ist
rot und silber (weiß). Helmzier: eine silberne Gans oder silberner
Schwan mit rotem Schnabel.
vorhanden, so dass der Besitz
von den Herzögen von
Hohenstaufen an sich gezogen wurde. Die Verwaltung übernahm in der
Folgezeit "die edle Familie der Hacken" (Haggen). Im Jahre 1257 wird ein
Walterus Haggo nobilis de Luterburch (Edler von Lauterburg) urkundlich
erwähnt. 1269 nennt er sich Waltherus Haggo de Welrstein, sein Siegel
führt aber die Umschrift etc. de Lutterburg. Hierbei handelt es sich um
das bereits ausgestorbene Geschlecht der Hack von Hoheneck. Nach dem
O.A. Ludwigsburg zufolge handelt es sich hierbei um Edelherren vom
Stamme der Heinrith, Geschlechtsgenossen der Hummel v. Lichtenberg. Nach
Mitte des 13. Jahrhunderts nennen sich auch von Lauterburg und
Wellstein (O.A. Aalen) und von Rosenstein (O.A. Gmünd). Das Wappen der
Familie Hacken von Hoheneck bzw. Hacken auf Lauterburg ist wie folgt
beschrieben: In Silber (weiß) drei rote Kugeln (2:1). Die Helmdecke ist
rot und silber (weiß). Helmzier: eine silberne Gans oder silberner
Schwan mit rotem Schnabel.
 vorhanden, so dass der Besitz
von den Herzögen von
Hohenstaufen an sich gezogen wurde. Die Verwaltung übernahm in der
Folgezeit "die edle Familie der Hacken" (Haggen). Im Jahre 1257 wird ein
Walterus Haggo nobilis de Luterburch (Edler von Lauterburg) urkundlich
erwähnt. 1269 nennt er sich Waltherus Haggo de Welrstein, sein Siegel
führt aber die Umschrift etc. de Lutterburg. Hierbei handelt es sich um
das bereits ausgestorbene Geschlecht der Hack von Hoheneck. Nach dem
O.A. Ludwigsburg zufolge handelt es sich hierbei um Edelherren vom
Stamme der Heinrith, Geschlechtsgenossen der Hummel v. Lichtenberg. Nach
Mitte des 13. Jahrhunderts nennen sich auch von Lauterburg und
Wellstein (O.A. Aalen) und von Rosenstein (O.A. Gmünd). Das Wappen der
Familie Hacken von Hoheneck bzw. Hacken auf Lauterburg ist wie folgt
beschrieben: In Silber (weiß) drei rote Kugeln (2:1). Die Helmdecke ist
rot und silber (weiß). Helmzier: eine silberne Gans oder silberner
Schwan mit rotem Schnabel.
vorhanden, so dass der Besitz
von den Herzögen von
Hohenstaufen an sich gezogen wurde. Die Verwaltung übernahm in der
Folgezeit "die edle Familie der Hacken" (Haggen). Im Jahre 1257 wird ein
Walterus Haggo nobilis de Luterburch (Edler von Lauterburg) urkundlich
erwähnt. 1269 nennt er sich Waltherus Haggo de Welrstein, sein Siegel
führt aber die Umschrift etc. de Lutterburg. Hierbei handelt es sich um
das bereits ausgestorbene Geschlecht der Hack von Hoheneck. Nach dem
O.A. Ludwigsburg zufolge handelt es sich hierbei um Edelherren vom
Stamme der Heinrith, Geschlechtsgenossen der Hummel v. Lichtenberg. Nach
Mitte des 13. Jahrhunderts nennen sich auch von Lauterburg und
Wellstein (O.A. Aalen) und von Rosenstein (O.A. Gmünd). Das Wappen der
Familie Hacken von Hoheneck bzw. Hacken auf Lauterburg ist wie folgt
beschrieben: In Silber (weiß) drei rote Kugeln (2:1). Die Helmdecke ist
rot und silber (weiß). Helmzier: eine silberne Gans oder silberner
Schwan mit rotem Schnabel.Auf
einem Totenschild in der evang. Kirche in Heubach findet sich das
Wappen der Hacken von Hoheneck. Eine genauere Prüfung ergab, dass es
gegen Ende des 16. Jahrhunderts gemalt wurde und wohl nach Grabsteinen
oder Schilden. Die vorhandene Umschrift kann keinen Anspruch auf
Richtigkeit machen. Die Farben des Schildes stimmen zu dem Hummel-Heinriethschen Wappen.
Warum wurde das Wappen für die Haugga-Narra geändert?
 Den
Vereinsgründern schienen die Farben weiß und rot für Karnevalisten zu
trist. Daher wurde das Wappen für die Familie der Narren in bunteren,
lebensfrohen Farben gestaltet. Dafür wurden die urtypischen
Fastnachtsfarben rot blau und gelb verwendet. Der Ritterhelm wurde durch
eine Melone ersetzt (man geht doch eher mit solch einer Kopfbedeckung
zum Karneval als mit einem geschlossenen Bügelhelm?!) und als Kleinod
ziert unser Wappen ein Enten-
Den
Vereinsgründern schienen die Farben weiß und rot für Karnevalisten zu
trist. Daher wurde das Wappen für die Familie der Narren in bunteren,
lebensfrohen Farben gestaltet. Dafür wurden die urtypischen
Fastnachtsfarben rot blau und gelb verwendet. Der Ritterhelm wurde durch
eine Melone ersetzt (man geht doch eher mit solch einer Kopfbedeckung
zum Karneval als mit einem geschlossenen Bügelhelm?!) und als Kleinod
ziert unser Wappen ein Enten-Die Lauterburg
 Der
Ortsteil Lauterburg wurde bereits im Jahr 1128 urkundlich erwähnt.
Lauterburg verdankt seine Entstehung einer bis ins 14. Jahrhundert stark
frequentierten Straße, die aus dem Remstal nach Heidenheim führte. Zur
Herrschaft Lauterburgs gehörte nicht nur der Weiler bei der Burg,
sondern ein stattlicher Besitz im Umkreis. Zum Hoheitsgebiet zählte auch
Aalen. Noch im Jahr 1386 musste Aalen, als es längst zur Stadt (1328),
ja selbst zur Reichsstadt (1360) erhoben war, Einkünfte an die Vogtei
Lauterburg abliefern. Weiterhin zählten eine ganze Anzahl von Orten zum
Herrschaftsbereich: Essingen, Lautern, Heubach, Oberböbingen, Bartholomä
und noch zahlreiche Weiler und Höfe. Nach ältestem urkundlichen
Nachweis war die Lauterburg eine Falz der Grafen von Dillingen und Sitz
einer Seitenlinie dieses Geschlechts.1276 verkauften die Hohenstaufer an
die Grafen von Öttingen. Hier wird ein Vogt "Hans von Aalen"
aufgeführt. 1358 wurde Lauterburg an Graf Eberhard den Greiner von
Württemberg verpfändet. Der Enkel jenes Eberhard des Greiners
verpfändete 1405 Lauterburg an die Herren von Woellwarth. Ein Rennwart
von Woellwarth kauft 1479 Lauterburg und Essingen.
Der
Ortsteil Lauterburg wurde bereits im Jahr 1128 urkundlich erwähnt.
Lauterburg verdankt seine Entstehung einer bis ins 14. Jahrhundert stark
frequentierten Straße, die aus dem Remstal nach Heidenheim führte. Zur
Herrschaft Lauterburgs gehörte nicht nur der Weiler bei der Burg,
sondern ein stattlicher Besitz im Umkreis. Zum Hoheitsgebiet zählte auch
Aalen. Noch im Jahr 1386 musste Aalen, als es längst zur Stadt (1328),
ja selbst zur Reichsstadt (1360) erhoben war, Einkünfte an die Vogtei
Lauterburg abliefern. Weiterhin zählten eine ganze Anzahl von Orten zum
Herrschaftsbereich: Essingen, Lautern, Heubach, Oberböbingen, Bartholomä
und noch zahlreiche Weiler und Höfe. Nach ältestem urkundlichen
Nachweis war die Lauterburg eine Falz der Grafen von Dillingen und Sitz
einer Seitenlinie dieses Geschlechts.1276 verkauften die Hohenstaufer an
die Grafen von Öttingen. Hier wird ein Vogt "Hans von Aalen"
aufgeführt. 1358 wurde Lauterburg an Graf Eberhard den Greiner von
Württemberg verpfändet. Der Enkel jenes Eberhard des Greiners
verpfändete 1405 Lauterburg an die Herren von Woellwarth. Ein Rennwart
von Woellwarth kauft 1479 Lauterburg und Essingen.Die
Oberamtsschreibung von Aalen vermutet, dass an der Stelle der späteren
Burg ursprünglich eine römische Befestigung gewesen sei. Für diese
Vermutung gibt es aber keine Bestätigung. Auf Grund übereinstimmender
Tatsachen darf Pfalzgraf Mangold III. aus dem Geschlecht der Grafen von
Dillingen-Donauwörth als
Erbauer der Lauterburg um 1125 angesetzt werden. Im Jahr 1470 wird eine
Bautätigkeit durch Rennwart von Woellwarth dadurch kundig, dass er 450
Gulden auf seine Pfandsumme geschlagen erhielt. Aus dieser Zeit stammt
wohl der starke innere Torbau, welcher heute noch steht.
 Um 1536 entstand die Vorburg. Mit dem äußeren Torbogen ist ein Gebäude verbunden. Ursprünglich
als Wohnung des Torwarts gedacht, welches aber später erweitert und bis
ca. 1880 als Schulhaus benutzt wurde.
Um 1536 entstand die Vorburg. Mit dem äußeren Torbogen ist ein Gebäude verbunden. Ursprünglich
als Wohnung des Torwarts gedacht, welches aber später erweitert und bis
ca. 1880 als Schulhaus benutzt wurde.  Am Ende des 16. Jahrhunderts
wurde das Herrenhaus neu erstellt. In diese umfassende Bautätigkeit
fällt auch der Bau einer Kirche, welches als einziges Bauwerk heute noch
vollständig erhalten ist. Von der Vorburg aus zog sich ein schmales
Bauwerk nach der Kirche hin, welches als Verbindungsgang zwischen
Schloss und Kirche diente. Im Schiff der Kirche hängt ein großes
Stiftungsgemälde, auf welchem unter anderem der Stifter der Kirche,
Georg Wolf von Woellwarth abgebildet ist.
Am Ende des 16. Jahrhunderts
wurde das Herrenhaus neu erstellt. In diese umfassende Bautätigkeit
fällt auch der Bau einer Kirche, welches als einziges Bauwerk heute noch
vollständig erhalten ist. Von der Vorburg aus zog sich ein schmales
Bauwerk nach der Kirche hin, welches als Verbindungsgang zwischen
Schloss und Kirche diente. Im Schiff der Kirche hängt ein großes
Stiftungsgemälde, auf welchem unter anderem der Stifter der Kirche,
Georg Wolf von Woellwarth abgebildet ist.Die
neue Lauterburg beherbergte nur vier Generationen, denn unter dem
Urenkel Georg Wolfs, Sebastian V. von Woellwarth brannte der Schlossbau
am 6. April 1732 völlig nieder. Heute ist die Ruine massiv vom Einsturz gefährdet.